Studium
MATNAT/mein_erleben/studium.html Vers. 1.2 24.06.2024
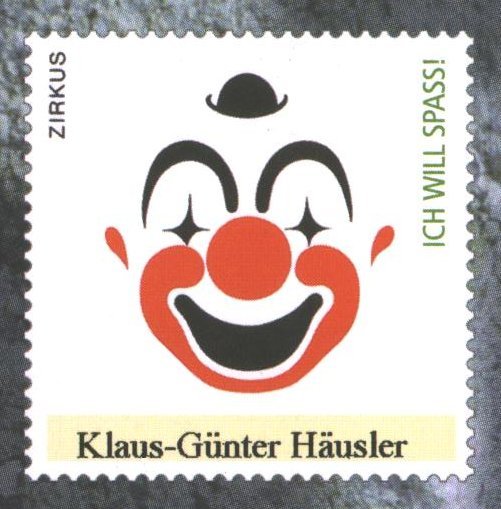
Studium MATNAT/mein_erleben/studium.html Vers. 1.2 24.06.2024 |
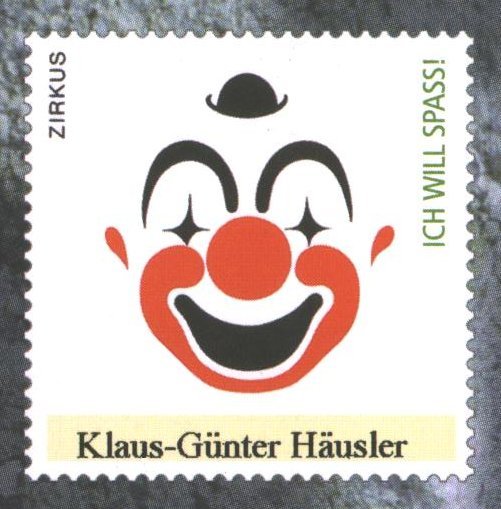 |
| Inhaltsverzeichnis
|
||
Vorwort In diesem Abschnitt wird meine Studienzeit anekdotenhaft wiedergegeben. Ebenso werden Ergebnisse meiner Tätigkeiten aufgeführt. Die Ergebnisse führten zu Weiterentwicklungen der Halbmikrotechnik in der Chemie. Andere Ergebnisse flossen in weiterführende Projekte, die wegen meines Ausscheidens aus der universitären Forschung nicht mehr weiter vorangetrieben wurden. Diese Projekte habe ich nur noch in der populärwissenschaftlichen Literatur verfolgt. Da mir die Biochemie weitgehend und die Quantenphysik und Quantenchemie vollständig fremd geblieben sind, beruhen meine Anmerkungen hierzu ausschließlich auf populärwissenschaftlichen Literaturquellen. Soweit mir das jetzt noch möglich ist, versuche ich die Quellen hierfür anzugeben.
|
||
Chemie-Studium Nach meiner Wehrdienstzeit hatte ich das Gefühl, viel Zeit auf dem Weg zum "Chemiker" verloren zu haben.
Das Vorstudium im ersten Semester bestand in einem zweimonatigen Vorlesungs- und Seminarteil. Den Abschluss bildete eine Aufnahmeklausur, die bestanden werden musste, um im zweiten Semester mit den Praktika beginnen zu können. Klar war, dass man das bestehen musste, zumal man bei zweimaligen Scheitern keinen weiteren Zugang zum Studium erhielt. Das war also ein verkappter Numerus Clausus. Allerdings erhielten wir, die Wehrdienst abgeleistet hatten, einen kleinen Bonus bei der Abschlussklausur.
Die Praktika im Studium der Chemie war erstmals im Zeitablauf schulmäßig strukturiert. Man begann zunächst mit einem Grundpraktikum (MAHR-Praktikum). Dann folgten das qualitiative, das quantitative, das organische und als letztes das physikalisch-chemische Grundpraktikum als Pflichtpraktika. In den Semesterferien wurden weiter Praktika angeboten. Da mir die Laborarbeit riesigen Spaß machte, belegte ich eine Vielzahl davon: Glasblasen, optische Methoden, Lötrohrpraktikum, Ionenaustauscher und noch nebenbei einen Computerkurs in FORTRAN. Nach dem Vordiplom in Chemie richtete ich mein besonderes Augenmerk auf die allgemeine und anorganische Chemie. Die analytische Ausbildung hörte ich bei Prof. Dr. Fritz Umland
Die physikalische Chemie belegte ich bei Prof. Ewald Wicke
|
||
Nebentätigkeiten Da meine finanziellen Mittel für das Studium nicht reichten, bewarb ich mich noch zusätzlich um studentische Hilfskraftstellen. Meine Eltern konnte mich nur mit einem kleinen Teil unterstützen und die staatliche Förderung, das "Honnefer Modell", fiel zu knapp aus. Ich hatte zwar aus meiner Schulzeit durch Nachhilfeunterricht eine Rücklage gebildet, die ich durch mein Wehrgehalt als Soldat noch aufgestockt hatte. Diese wollte ich nicht angreifen. Daher war ich auf der Suche nach eine bezahlten Tätigkeit im Wissenschaftsbereich als studentische Hilfskraft. Vom zweiten bis zum vierten Semester half ich während der Laborzeit in der Chemikalienausgabe vormittags und nachmittags je zwei Stunden. Damit war das finanzielle Problem gelöst, nur fehlte mir jetzt die Zeit im Laborpraktikum. Das konnte ich vermeiden, indem ich meine für den nächsten Praktikumstag vorgesehene Arbeiten minutiös plante. Das strukturierte Arbeit führt sogar dazu, dass ich am Ende mit meinen Aufgaben im Praktikum eher fertig wurde und ich dann anderen noch geholfen habe. Mir wurde aber auch geholfen: so übernahmen Kommilitonen nötigenfalls kleinere Arbeiten, wie etwa das Herausnehmen von Proben nach dem Trocknen aus dem Trockenschrank oder das Nachfüllen von Lösungen beim langwierigen Filtrieren. Zum Programmieren kam ich, weil ich hoffte, meine Flüchtigkeitsfehler beim nummerischen Rechnen durch den Einsatz eines Computers auszugleichen. Bis zu diesem Zeitpunkt rechnete man mit dem Rechenschieber und Logarithmen-Tabellen. Darin war ich durchaus geschickt, es blieb aber weiter bei meinen Flüchtigkeitsfehlen, da man mit Logarithmen und Rechenstab nicht alle Rechenarten durchführen konnte. Ich besaß sogar Ein BI-Taschenbuch mit achtstelligen Logarithmen, worin im Vorwort besonders hingewiesen wurde, dass die Tabellen frei sind von Rechen- und Druckfehlern! Ein zweiter Umstand faszinierte mich. Ein ehemaliger Klassenkamerad kam im zweiten Semester von der TH Hannover, programmierte dort als wissenschaftliche Hilfskraft und verdiente damit für einen Studenten erstaunlich viel Geld. Das ging bei ihm teilweise zu Lasten des Studiums, was ich unbedingt vermeiden wollte. Der FORTRAN-Programmierkurs fand am Institut der "Nummerischen Mathematik" statt, das Fach Informatik gab es noch nicht, ebenso wenig wie es Taschenrechner gab!
Meine Computerkenntnisse verschafften mir mehrere halbe studentische Hilfskraftstellen. Sie sollten meinen weiteren Weg in Forschung und Wissenschaft begleiten, wie, berichte ich an anderen Stellen.
|
||
Diplomarbeit Nach dem Fehlstart mit dem ersten Thema der Diplomarbeit "Magnetochemische Untersuchung an der Verbindung K3W2Cl6 erhielt ich ein neues Thema. Im Arbeitskreis ist durch H. Menke die Käfigverbindung Ge38Sb8J8 entdeckt, beschrieben und weiter untersucht worden. Es zeigte sich, dass diese Verbindung nur eine aus der neuen Gruppe (Si,Ge)38(P,As,Sb)8(Cl,Br,J)8 war In den Käfigverbindungen dieses Strukturtyps bilden die Elemente der vierten Hauptgruppe (Si, Ge) mit den Elementen der fünften Hauptgruppe (P, As, Sb) ein Gerüst aus tetraedrisch gebundenen Atomen. Die Elemente der fünften Gruppe haben aber ein Elektron zu viel, um in ein tetraedrisches Gitter zu passen. Das zeigt sich auch daran, dass es zum Beispiel im binären System Ge-Sb keine Verbindung gibt. Wenn aber das überschüssige Elektron an ein Atom der siebten Hauptgruppe abgegeben werden kann, passt sich das Element in die Tetraeder-Struktur ein. Damit wird das Halogenatom Hal zu einem negativ geladenen Halogenid Hal-. Durch die negative Aufladung der Hülle ist das Ion deutlich größer als das Hal-Atom. Das Halogenid-Ion wird in die Hohlräume des tetraedrischen Gitters aufgenommen und stabilisiert so die Struktur. Dabei werden zwei verschiedene Hohlräume (Käfige) gebildet, sechs größere und zwei kleinere. H. Menke fand nun eine Merkwürdigkeit. Bei dem präparativen Ansatz, die Verbindungreihe Ge38Sb8BrxI8-x zu bilden zeigte sich eine Anomalität in der Gitterkonstante der Mischkristallen. Entgegen der Erwartung, dass die Gitterkonstante mit steigendem Iod-Gehalt, linear ansteigt, zeigte der Mischkristallansatz Ge38Sb8Br2I6 eine kleinere Gitterkonstante als die von Ge38Sb8Br8. In der Diplomarbeit sollte dem nachgegangen werden. Das Ergebnisse:
Methoden:
|
||
Promotion Aus der Diplomarbeit ergab sich die Fragestellung, ob und wie gut die Zusammensetzung der Elemente in der Verbindung Ge38Sb8J8 bzw. Ge38Sb8I8 Um die Verhältnisse zu klären, mussten präzisere quantitative Bestimmungen gemacht werden. Da homogen Einkristalle nicht zur Verfügung standen, musste eine andere Methode gefunden werden. Dazu wurde beim Züchten der Kristallen unterschiedliche Temperaturprofile erzeugt. Diese wurden angeschliffen und halbquantitativ mit der Elektronenmikrosonde untersucht. Eine ausreichende Genauigkeit bei der Bestimmung der Elemente konnte nicht erreicht werden, da die Absorptionsverhältnisse der charakteristischen Wellenlängen der Elemente von der Konzentration abhängig ist, die aber gerade nicht bekannt ist. Eichsubstanzen zum Vergleich standen nicht zur Verfügung. Somit konnte die Verhältnisse nur relativ bestimmt werden. Der Zusammenhang lies sich eindeutig als Phasenbreite Ge38+xSb8-xI8-x beschreiben. Es scheint, dass die Abgabe eines Elektrons dem Antimon ermöglicht, einen Tetraederplatz im Germaniumgitter zu einzunehmen. Das Iod nimmt das Elektron auf und stabilisiert die Tetraederstruktur durch eine quasi ionische Antimon-Jod-Verbindung. Iod ist sozusagen ein "Verbindungsvermittler" zwischen unvereinbaren atomaren Eigenschaften anderer Elemente.
|
||
Der Gedanken führte dazu, drei Elemente A, B und C zu finden, die jeweils binär keine Verbindung A-B, A-C und B-C bilden. In diesem Fall bestünde die Möglichkeit, eine ternäre Verbindung A-B-C zu finden, die dann auch eine ungewöhnliche Struktur haben sollte. In der damaligen Zeit bestand die Recherche ausschließlich in Literaturarbeit mit klassischen Büchern in real existierenden Bibliotheken. Ausgangspunkt waren die Bücher von
Hansen
|
||
Literatur - Datenbank Die notwendige umfangreiche Literatur-Recherche und das das Aufkommen der EDV lenkten meine Aufmerksamkeit auf elektronische Datenbanken. In unserem Arbeitskreis existierte ein Datensammlung von ca. 1800 Randlochkarten Der Aufwand war sehr groß. Erst mussten die relevanten Literaturstellen gesucht werden, diese dann auf Karteikarten übertragen werden, mit dem Stichwortkatalog abgeglichen und die Randlöcher gestanzt werden. Da die Literaturarbeit war wegen der Wichtigkeit bis auf reine manuelle Tätigkeit "Chefsache". Meine Themen waren in der Datenbank nicht vorhanden. Ich machte mir ein eigenes Literatur-Datenbankprogramm in der Computersprache FORTRAN und Hatte nach kurzer Zeit etwa 800 Literaturstellen auf Lochkarten erfasst. Da damals Speicher und Rechenzeit kostbar waren, hatte ich nur die Stichworte erfasst die auf eine manuelle Aufzeichnung verwiesen. Allerdings konnte ich wesentlich mehr Stichwort vorsehen und verwalten als das mit Randlochkarten möglich war. Auch die Suche nach verschachtelten Stichworten mit logischen UND und "nicht UND" und "inklusiven" und "exklusiven ODER" waren nun möglich. Die Leistungsfähigkeit der Datenbanksuche überzeugten, so dass ich den Auftrag erhielt, auch die "Chef-Literatur"-Randlochkarten auf Lochkarten zu übertragen. Das kostete mich einiges an wertvoller Zeit, andererseits erhielt ich nun auch die Möglichkeit, drei Tage am Max-Planck-Institut für Kohleforschung in Mühlheim zu verbringen, um mir das dortige Literaturprogramm anzusehen. Ich erhielt des FORTRAN-Programm auch auf Lochkarten. Die Schwierigkeit bestand allerdings in der Übertragung von dem dortigen DEC Rechner der PDP-8 Architektur mit 12-Bit/WORD auf den IBM-Rechner mit 36-bit/Wort umzuschreiben. Ich glaube, ich habe das Problem durch Speicherplatzüberlagerung mit 8-Bit/Byte-Vektoren gelöst.
Nach dem Ausscheiden aus dem wissenschaftlichen Betrieb hatte ich viele Jahre keinen Zugang mehr zu Computern und wissenschaftlichen Literatur. Ich bemerkte aber, wie die Literaturarbeit nach und nach durch den Einzug der Informationstechnik (IT) erleichtert hat. Erst bei meinem "Studium im Alter" versuchte ich noch einmal gezielt Veröffentlichungen durch Internet-Recherche in Datenbanken der Universität Münster zu finden. Das Ergebnis meiner Bemühungen war aufschlussreich und in gewisser Weise ernüchternd, was die meine Leistungsfähigkeit im Vergleich zu Studierenden betraf, aber auch die Möglichkeiten und Grenzen der IT aufzeigte. Möglicherweise wird der Einzug der KI hier weitere Fortschritte bringen.
|
||
Halbmikrotechnik
Bei Prof. Dr. Harald Schäfer
|
||
Literatur
|
||
|
||
|